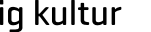Neue Wege für Kulturfinanzierung
Update: Nachlese verfügbar!
Alternativfinanzierungen werden für Kunst- und Kulturprojekte immer wichtiger – nicht nur, weil öffentliche Budgets unter Druck stehen, sondern auch, weil sie mehr Unabhängigkeit, Solidarität und Teilhabe ermöglichen.
In dieser Lunch Lecture gaben Mika Palmisano (Verein GemSe) und Thomas Auer (kulturspenden.at) praxisnahe Einblicke in Direktkredite, Crowdfunding und andere Formen gemeinschaftlicher Finanzierung. Elena Stoißer (IG KiKK) moderierte das Gespräch und beleuchtete mit den Gästen, wie solche Modelle gerade jetzt neue Spielräume für Kulturinitiativen in der Region schaffen können. Im Artikel finden sie eine Kurzzusammenfassung der Lecture.

Hier finden sie die Kurzzusammenfassung der Lunch Lecture am 25.09. 2025:
Neue Wege der Kulturfinanzierung
Die Veranstaltung brachte Kulturinitiativen aus Kärnten/Koroška und darüber hinaus zusammen, um über alternative Finanzierungsformen für Kulturprojekte zu sprechen. Angesichts stagnierender öffentlicher Förderungen und steigender Kosten ging es um Strategien, die Unabhängigkeit stärken und Teilhabe ermöglichen. Impulsgeber:innen waren Mika Palmisano vom Verein Gemse und Thomas Auer von der Kulturplattform OÖ, Mitbegründer der Plattform kulturspenden.at.
Die Gemse: Ein Kultur- und Wohnprojekt im ländlichen Raum
Der Verein Gemse ist ein queer-feministisches Kultur- und Wohnprojekt im Gailtal (Kärnten/Koroška). Es bietet Wohnräume, Ateliers, einen Seminarraum sowie Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen. Die Gemse versteht sich als offener Ort für Menschen, die ihre Grundsätze teilen: Solidarität, Barrierefreiheit und Gemeinwohlorientierung.
Besonders bemerkenswert ist, dass das Projekt sein Haus nicht über Bankkredite, sondern über Direktkredite von Privatpersonen finanziert hat. Diese Form der Finanzierung wurde durch das österreichische Alternativfinanzierungsgesetz (2015) erleichtert. Statt Zinsen zu zahlen, verstehen die Kreditgebenden den Zinsverzicht als Spende an das Projekt.
Unter dem Motto „Lieber 1.000 Freund:innen im Rücken als eine Bank im Nacken“ sammelte die Gemse in nur drei Monaten rund 400.000 Euro und legte davon stets zehn Prozent als Liquiditätsreserve zurück. Damit wird nicht nur das Haus finanziert, sondern auch eine Form der Entprivatisierung von Raum und eine gelebte Solidaritätspraxis umgesetzt.
Mischfinanzierung und Community-Bindung
Für den laufenden Betrieb setzt die Gemse auf eine Mischfinanzierung:
- Die sogenannte „Goldene Gams“ ermöglicht regelmäßige Kleinbeiträge von Unterstützer:innen (meist 10–20 Euro pro Monat).
- Projektbezogenes Crowdfunding kommt bei konkreten Anschaffungen zum Einsatz, etwa für einen barrierefreien Lift.
- Zusätzliche Mittel stammen aus punktuellen Spenden, Stiftungsgeldern und in kleinerem Umfang aus öffentlichen Förderungen.
Die Finanzierung ist bewusst gemeinschaftsbasiert. Menschen investieren direkt in Orte, die sie schätzen, und unterstützen damit kulturelle und soziale Teilhabe.
kulturspenden.at: Eine Plattform von der Szene für die Szene
Thomas Auer stellte mit kulturspenden.at eine Plattform vor, die speziell auf die Bedürfnisse gemeinnütziger Kulturvereine in Österreich zugeschnitten ist. Sie bietet:
- Organisationsspenden für den laufenden Betrieb,
- Projektbasierte Kampagnen für konkrete Vorhaben,
- künftig auch wiederkehrende Spenden im Abo-Modell.
Anders als kommerzielle Plattformen wie Startnext oder Kickstarter ist kulturspenden.at kostengünstiger, weniger komplex und versteht sich als Teil der Kulturszene. Es fördert nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Sichtbarkeit und Vernetzung der Projekte.
Bisher wurden auf der Plattform rund 60–70 Spendenaufrufe gestartet, darunter etwa 20 projektbasierte Kampagnen. Erfolgreiche Beispiele sind der „Kulturwald“ der KUPF OÖ oder die Sanierung des Bauhofs Ottensheim.
Erfolgsfaktoren für Crowdfunding
In der Diskussion wurde deutlich, dass der Erfolg von Crowdfunding-Kampagnen weniger von viraler Reichweite als von persönlichen Beziehungen und Netzwerken abhängt.
- Die eigene Community sollte vor Kampagnenstart aktiviert werden; oft kommen die ersten 20–30 Prozent der Summe aus dem direkten Umfeld.
- Klare, realistische Ziele und eine verständliche, emotionale Ansprache sind entscheidend.
- Persönliche Beteiligung und einfache Formen der Anerkennung – etwa ein Namensschild am neuen Kulturstuhl – wirken besser als aufwendige „Goodies“.
- Crowdfunding ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zu öffentlichen Förderungen und kann die Resilienz und Selbstbestimmung von Kulturinitiativen stärken.
Politische und strukturelle Perspektiven
Neben den praktischen Fragen betonten die Vortragenden die politische Dimension alternativer Finanzierungswege:
- Sie tragen zur Selbstermächtigung von Kulturinitiativen bei, die sich nicht nur auf staatliche Förderungen verlassen wollen.
- Netzwerke wie Habitat oder die neue Plattform Krötenwanderung erleichtern den Austausch über Rechts- und Finanzierungsmodelle.
- Langfristig können solche Modelle dazu beitragen, Räume der Kulturproduktion dem Markt zu entziehen und im Gemeinwohl zu verankern.
Fazit
Die Veranstaltung zeigte, dass Kulturfinanzierung neu gedacht werden kann: durch gemeinschaftliches Engagement, Transparenz und den Willen, Verantwortung für kulturelle Infrastruktur zu übernehmen. Alternative Modelle wie Direktkredite oder spendenbasiertes Crowdfunding sind kein Ersatz für öffentliche Kulturförderung, aber ein wirksames Mittel, um Projekte unabhängiger zu machen und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern.