Es gibt immer Alternativen - Gabu Heindl im Gespräch
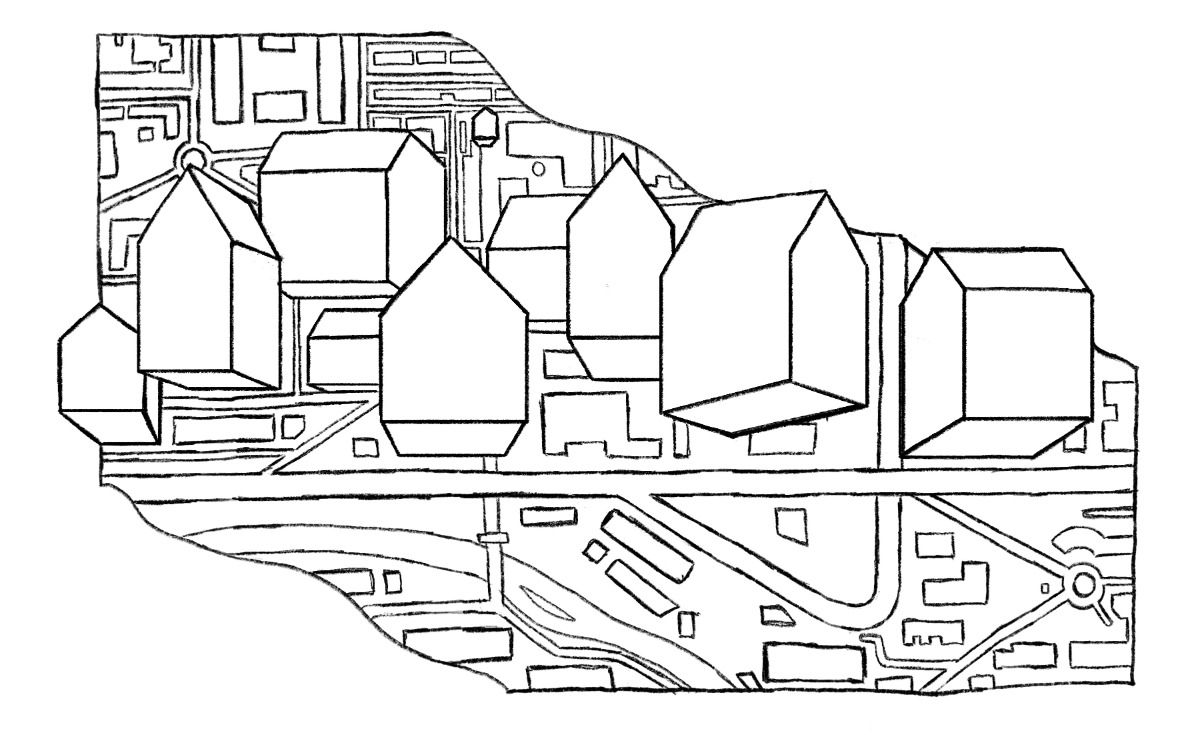
IG Kultur Steiermark: Als Architektin, Stadtplanerin und Autorin beschäftigst du dich mit radikaler Demokratie, sowohl in der akademischen Arbeit als auch in der Praxis. Ich würde mich gerne im Interview auf zwei Publikationen beziehen, die letztes Jahr erschienen sind: Dein Buch "Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung“ und die Studie, die du für die Arbeiterkammer Wien durchgeführt hast, mit dem Titel "Gerechte Stadt muss sein! Studie zur Bestandsanalyse und Zukunftsorientierung einer gerechte(re)n Stadtplanung mit Schwerpunkt Wien“. In beiden Publikationen arbeitest du mit dem Konzept der radikalen Demokratie. Kannst du uns kurz erklären, was wir darunter verstehen sollen?
Gabu Heindl: Die radikale Demokratietheorie formuliert diesen einfachen, aber nicht leicht umzusetzenden Gedanken: Dass selbst in Zeiten, oder gerade in Zeiten, in denen Demokratie in Gefahr ist, in denen Demokratie längst noch nicht das ist, was sie ist, oder es auch technisch und ökonomisch aus unterschiedlichen technokratischen Gründen heraus vermeintlich jetzt gerade nicht den Moment dafür gibt, Demokratie zu verbessern, genau dann sollte Demokratie eigentlich weiter vertieft werden, also eine Demokratisierung der Demokratie angestrebt werden und nicht ein allzu leichtes "sie aufgeben" oder auch "verschieben" passieren. Das sagt eigentlich die radikale Demokratietheorie. Wir müssen immer versuchen, sie zu radikalisieren, sozusagen ein radikaleres Verständnis davon zu erhalten. Und radikal in diesem Zusammenhang hat nicht die negative Bedeutung, in der dieser Begriff oft weitläufig verwendet wird – als Synonym zu "extrem" –, sondern radikal kommt vom lateinischen Wort Radix, also der Wurzel, und geht den Dingen auf den Grund. Radikal versucht auch im Sinne eines Wandels durchaus einen konzeptuell echten Paradigmenwechsel anzustreben und nicht schnellen Lösungen, die oft nur Anpassungen an elende Verhältnisse sind, hinterherzulaufen.
IG Kultur Steiermark: Wie zeigt sich das in der Praxis der Stadtplanung bzw. was sind die Prinzipien der radikalen Demokratie in der Stadtplanung?
Gabu Heindl: Auf die Stadtplanung übertragen könnte man sagen, es wird immer wieder postpolitisch1 – das ist auch ein Begriff der radikalen Demokratietheorie – formuliert, dass etwas gar nicht anders geht. Es ginge, so heißt es, nicht anders, als dass Städte beispielsweise mit großen spekulativen Investoren zusammenarbeiten und am Ende dann vielleicht mit Häusern und Stadtteilen konfrontiert sind, die gerade nicht denen, die eigentlich dringend Wohnungen suchen, eine solche auch bereitstellen.
Radikaldemokratisch verstanden würden wir zunächst einmal hinterfragen, warum uns eigentlich ständig erklärt wird: "There is no alternative!", dass es keine Alternativen gäbe zu gewissen Finanzierungskonzepten, zu gewissen stadtentwicklungstechnischen Dynamiken. Dem müssen wir etwas entgegenstellen: Erstens gibt es immer Alternativen und auch immer viel mehr als wir auf den ersten Blick sehen und zweitens müssen wir deutlich machen, dass eine Stadtentwicklung, die am Ende Menschen in ihrer Wohnungsnot nicht hilft, aber mehr spekulativen Stadtraum produziert, keine demokratische Lösung oder kein demokratisches Vorgehen in der Stadtentwicklung ist. Dann sollte hier entsprechend sehr konsequent und grundsätzlich gefordert werden: Wenn schon etwas gebaut wird, wenn es Entwicklung geben soll, dann muss sie eigentlich maximal sozial sowie maximal ökologisch sein. Radikaldemokratisch heißt, viel öfter und genauer zu hinterfragen, wer und was eine Stadt ausmacht und wem was dienen soll.
IG Kultur Steiermark: Weil wir auch in Graz merken, dass wir noch immer weit weg sind von diesem Schritt: Welche Voraussetzungen brauchen wir für diesen Schritt? In Bezug auf die Stadtpolitik, auf die Investor:innen, aber auch auf die Bewohner:innen.
Gabu Heindl: Für eine radikaldemokratische oder auch solidarische Stadtentwicklung brauchen wir ein anderes Verständnis sowohl von Investition als auch von Entwicklung – also ein Demokratisieren von Projektentwicklung. Wer sind eigentlich die Investor:innen oder wer sind die Entwickler:innen der Stadt? Das sind alle Menschen, die in einer Stadt wohnen und sie auf verschiedenen Ebenen stets mitentwickeln. Das ist selbstverständlich auch jene Politik, die proaktiv gemeinnützig wirkt und sich als Vertreterin der Öffentlichkeit versteht. Dazu brauchen wir auch eine kritische und selbstkritische Planung und Planungskultur, sowohl auf der Verwaltungsebene als auch auf der fachlichen Ebene. Das betrifft eben Leute wie mich und viele meiner Architekturkolleg:innen und Stadtplaner:innen. Es braucht aber auch Anerkennung und Unterstützung der Mitarbeit einer aktiven Zivilgesellschaft – was ich Popular Agency nenne. Wie ich schon in meinem Buch Stadtkonflikte dargelegt habe, sind "Politik, Planung und Popular Agency" drei Ebenen, an denen wir unter anderem an Schrauben drehen müssen. Die Abkürzung PPP ist an dieser Stelle auch eine sehr bewusste Setzung meinerseits, denn wir brauchen ein „anderes PPP“, anders als jenes, das wir in der neoliberalen Stadtplanung so gut kennen, nämlich Public Private Partnerships: Das ist ein immer wiederkehrendes Auslagern der Entwicklung von Stadt in eine finanzialisierte und profitorientierte Privatwirtschaft. Mein anderes PPP wäre so eine Kombination: Politik, Planung und Popular Agency.
IG Kultur Steiermark: Kunst und Kultur bzw. Kulturräume werden in dieser neoliberalen Stadtplanung meistens als Vorreiter der Gentrifizierung instrumentalisiert, um Stadtteile attraktiver zu machen bzw. die Immobilienpreise zu steigern. Welche Rollen sollen Kulturräume im Rahmen einer radikaldemokratischen Stadtplanung spielen?
Gabu Heindl: Grundsätzlich müssten wir unterscheiden zwischen bereits institutionalisierter Kultur und selbstorganisierter Kultur – sozio-kulturellen Räumen, die aus Bedürfnissen der Zivilgesellschaft heraus entstehen. Leider gibt es da eine Verquickung mit der Finanzialisierung und Kommerzialisierung von städtischem Raum. Denn diese passiert allzu oft genau in den Räumen, die zunächst günstig sind, leer stehen und somit auch für kulturelle Nutzung vorhanden wären. Interesse an diesen Räumen hat aber nicht nur die kulturelle Szene, sondern haben eben auch profitorientierte Investor:innen. Um herauszufinden, wo es Sinn machen würde, im größeren Rahmen zu investieren, wird die Kulturszene hierbei manchmal als eine Art Vorweg-Scouting verwendet. Eigentlich müssten wir da hinkommen, dass Stadtentwicklung und Stadtverwaltung samt Planungspolitik kulturelle Orte nicht nur als rebellisch oder im besten Sinn als produktiv rebellisch sehen, sondern sie sollten verstehen, dass es auch um ein Sichern leistbarer und offener Räume geht. Das könnte man auch stadtplanerisch unmittelbar mit allen vorhandenen Stadtplanungsinstrumenten unterstützen, damit diese eben nicht den üblichen Weg der Gentrifizierung oder der Finanzialisierung, also des Ausverkaufs der Räume, gehen. Das sollte doch in Graz hoffentlich sehr möglich sein.
IG Kultur Steiermark: Oft verteidigt die Stadtpolitik die Privatisierung des Stadtraums mit Argumenten: Schaffung von Mehrwert für die Stadt, Aufwertung der Gebäude bzw. Stabilität für die Kunst- und Kulturakteur:innen.
Gabu Heindl: Die Kulturszene und (sozio)kulturelle Räume erhalten Stabilität nicht durch Gentrifizierung oder Institutionalisierung, ebenso nicht durch eine Verschönerung der Häuser. Stabilität ist durch eine Absicherung des Mietvertrags, durch eine Absicherung der Leistbarkeit wie auch durch die Absicherung einer wirklichen Zugänglichkeit gegeben. In dem Sinne müsste Stabilität also eher heißen: Wie halte ich die Räume dauerhaft so offen, dass sie sich kontinuierlich verjüngen bzw. erneuern können? Es sollte auch keinen Wettbewerb dahingehend geben, welche Räume wichtiger sind, für junge oder ältere Menschen, an diesen oder jenen Orten. Es ist auch wichtig, eher maximal viele solcher leicht zugänglichen und offen bespielbaren oder auch gezielt kuratierbaren städtischen Räume zu fordern, die im Grunde etwas Notwendiges mit sich bringen: Dass sie nicht teuer sind, dass sie nicht zu viele Barrieren haben im Sinne dessen, wer mitmachen oder wer teilhaben kann, und gleichzeitig aber auch, dass sie geschützte Räume sind. Es ist aber oftmals gar nicht so leicht, eine Balance zu finden: zwischen geschützt und offen, und auch dass sie nicht zu einem Antreiber von Gentrifizierung und der Erhöhung der Mieten, also einer marktwirtschaftlichen Aufwertung eines Viertels werden.
Bei der Aufwertung des städtischen Raums sollten wir uns immer fragen: Für wen wird der Wert eines Stadtteils gesteigert, und was verstehen wir überhaupt unter diesem Wert? Natürlich sollen Stadtteile verbessert werden. Doch es kann nicht sein, dass durch coole, schöne, selbstorganisierte Räume am Ende ein Stadtteil so im Wert steigt, dass dort keine leistbaren Wohnungen mehr vorhanden sind. Das ist absurd! Und dennoch ist es genau dieser Weg, der im neoliberalen Verständnis des Städtewettbewerbs leider oftmals auch für die Politik Sinn macht. Aus diesem Paradigma müssen wir längst heraus und hin zu einer Stadtverwaltung und zu gewählten Stadtpolitiker:innen, die viel eher ein gutes Leben für alle im Blick haben oder eine Idee davon, dass wir die Stadt auch aus einer solidarischen Ökonomie heraus entwickeln können.
IG Kultur Steiermark: In der Studie "Gerechte Stadt muss sein!" ist neben dem Wohnen und dem öffentlichen Raum die Teilhabe ein hervorgehobener Themenbereich. Warum ist die Teilhabe an einer Stadt wichtig? In welchem Rahmen wäre eine breite Teilhabe möglich?
Gabu Heindl: Für mich spannt sich das Konzept der Teilhabe sehr breit auf und betrifft immer ein Recht, an allem, was eine Stadt bietet, teilzunehmen bzw. an der Stadt mitzuwirken. Das kann ein passiver oder aktiver Prozess sein. In die Teilhabeprozesse sollten nicht nur die weiße Mittelschicht oder nur Menschen, die keine Betreuungspflichten haben, eingebunden werden, und deshalb verlangen diese Prozesse ein wirkliches Commitment, das eine Umverteilung von Mitteln, bis hin zu Geld, mitdenkt. Dazu gibt es durchaus viele Instrumente, auch gute kritische Lektüre und Wissen, wie eine aktive Teilhabe im Sinne des Mitgestaltens, Mitentscheidens oder auch der Mitentwicklung möglich ist.
Nur zu sagen "Wir sind jetzt offen.", ohne dabei einen gesteuerten Prozess vorzubereiten und gleichzeitig mit entsprechenden finanziellen bzw. strukturellen Mittel auszustatten, ist zu wenig. Städte setzen oft sehr viele Eigenmittel in Bewegung, um sich für Investoren zu öffnen bzw. Großkapital anzulocken. Diese Budgets könnten auch in Formen von Teilhabe investiert werden, die stärker in eine Verbreiterung und eine Demokratisierung der Teilhabe gehen. Es wäre ein interessantes Forschungsprojekt nachzuschauen, wie viel Geld bzw. welche Mittel Städte in die Aktivierung von Privatwirtschaft investieren, und inwiefern hier eigentlich ein deutlich höheres Haushaltsbudget angebracht wäre, um solidarisch ökonomische, kulturelle Investments in der Stadt möglich zu machen.
IG Kultur Steiermark: Zu dieser Freistellung von Mitteln, um Investoren zu locken, zählt auch oft die öffentliche Finanzierung von kulturellen Räumen bzw. von künstlerischen und kulturellen Inhalten.
Gabu Heindl: Genau. Im Moment ist die Arena in Wien ein sehr gutes Beispiel für ein problematisches Verhältnis zwischen Stadtentwicklung und Kulturräumen. Die Arena war ein Schlachthof und ist in den 70er-Jahren aus einer Besetzung heraus entstanden. Es gab lange Kämpfe um eine Möglichmachung dieses Raumes. Inzwischen ist die Arena ein wichtiger Kulturort für Wien geworden. Ohne sie gäbe es viele internationale Konzerte nicht. Mitsamt den Open Airs, die dort möglich sind, gibt es damit im Osten von Wien, wo es eigentlich bislang nur Industrie gab, auch einen geschützten Raum und einen Möglichkeitsraum dahingehend, laut zu sein. Die Stadt Wien hat nach der Besetzungsphase und in der Phase der „Institutionalisierung“ auch einiges in Form von Förderungen mitinvestiert. Im Zuge einer großen Stadterweiterung – die Einwohner:innenzahl von Wien wächst stets – sind Bereiche rund um die Arena als Stadtentwicklungsbereiche ausgewiesen worden. In vollem Bewusstsein des Ortes wurden drei große Wohntürme neben der Arena errichtet und jetzt gibt es Klagen der Wohnenden aus den Luxusappartements heraus, dass die Arena zu laut ist bis hin zur Frage, ob dieser Ort überhaupt bestehen soll. Also, der bestehende Musikraum ist zunächst der Grund dafür, warum die Lage überhaupt aufgewertet wird. Dann gibt es das Investment in diese drei Hochhäuser, und diese bringen jetzt den bestehenden Raum in Gefahr. Am Ende ist es so, dass nicht die Turmentwickler, sondern die Öffentlichkeit in Form der Stadt Wien, in die technischen Nachrüstungen der Arena investiert, damit es für die Wohnenden nicht so laut ist. Die Öffentlichkeit übernimmt das Abdecken des Risikos und auch das Reparieren, während die Investor:innengruppen der Wohnhäuser hier keine Verpflichtungen mehr haben bzw. Verantwortung übernehmen müssen. Die Arena ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass es selbst bei einem so institutionalisierten Ort im Nu sein kann, dass dieser hinterfragt wird.
IG Kultur Steiermark: Kulturelle bzw. soziokulturelle Räume sind oft Orte, an denen eine konsumfreie Teilhabe in sehr kleinem, aber doch bedeutendem Ausmaß stattfindet. Sie geben gewissen Gruppen häufig die fehlende Sichtbarkeit in der Stadt und stärken die Gemeinschaften nach innen. Aus der Perspektive von Diversität bzw. Intersektionalität2, welche Rolle spielen Kulturräume für die Stadt?
Gabu Heindl: Die Frage ist hier auch, was wir unter Kulturräumen verstehen. Es geht darum, dass es überhaupt Freiräume in der Stadt gibt, wo sich Menschen treffen können, um gemeinsam etwas zu unternehmen oder Sprache gemeinsam zu üben oder eben "klassische" Kultur auszuüben. Breit gefasst, geht es hier um Räume, die außerhalb der eigenen Wohnung liegen und dennoch innerhalb eines Raumes, der überdacht ist und geheizt werden kann, weil nicht alles im Außenraum möglich ist, besonders in der kalten Jahreszeit. Räume jenseits des Privatraumes und eines institutionalisierten Raumes, wie der Oper oder dem Theater, wo eine Begegnung mit anderen möglich ist. Solche Räume sollen möglichst öffentlich, frei und zugänglich sein, wobei sich die Frage der (Selbst-)Verwaltung stellt. Für eine möglichst große Diversität der Räume ist es wichtig, dass eine Stadt mit ihren Mittel dahingehend mithilft, dass es weniger verschlossene Räume gibt, wenn diese etwa als Leerstand missbraucht werden, und mehr offene Räume, die noch nicht absolut programmiert sind – also dass es mehr Räume für selbstentstehende bzw. selbstorganisierte Initiativen gibt. In diesem Sinne sollte es die Aufgabe einer progressiven Stadtentwicklung und Stadtplanung sein, diese Möglichkeit, sich zu organisieren und Raum dafür zu finden, zu unterstützen.
Dabei wäre es zudem wichtig, dass in diesem Zusammenhang die Diversität unserer Migrationsgesellschaft auch in dem Prozess abgebildet wird, dass es für jede*n die Chance gibt, Gestaltung zu übernehmen oder sich einen Raum zu nehmen. Das heißt, für Menschen mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Herkünften Räume zu gewährleisten. Und wenn es auch nur dafür ist, sich aus ihrer eigenen Herkunft heraus mit anderen zu treffen als ihrer eigenen Familie. Das ist doch das Schöne an diesen halböffentlichen oder eben doch öffentlichen, aber geschützten Räumen: Sie ermöglichen es, auf andere treffen zu können, mit denen man nicht die familiären Wohnräume teilt bzw. mit denen man nicht das entsprechende kulturelle Kapital oder auch monetäre Kapital teilt. In diesem Dazwischen ist es wichtig, möglichst viel Freiraum für eine diverse und migrantisch geprägte Gesellschaft zu bieten. Das widerspricht komplett der momentanen Praxis, Räume ständig zu definieren, zu institutionalisieren oder auch zu finanzialisieren.
IG Kultur Steiermark: Derzeit gibt es in Graz den Trend, dass neue Wohnsiedlungen dicht wachsen und freie Räume tendenziell verschwinden. Dazu ist Graz, wie alle anderen Städte, mit den multiplen Krisen der Gegenwart konfrontiert und somit auch herausgefordert das neoliberale Paradigma zu hinterfragen. Eine Alternative muss lebendig und von vielen getragen werden. Welche Allianzen brauchen wir, um diesen Paradigmenwechsel anzustreben und in Gang zu bringen?
Gabu Heindl: Wir brauchen alle Allianzen, die sich irgendwo auftun. Da sollten wir gar nicht allzu nobel oder differenziert sein. Wobei es selbstverständlich gilt, Grenzen zu rassistischen, zu sexistischen, zu menschenverachtenden Partner:innen zu ziehen, mit denen eine Allianz eben nicht möglich ist. Ein gutes Beispiel für eine tolle Allianz ist ein kleiner Verein in Wien, der "Kicken ohne Grenzen" heißt. Wenn sich Fußball die Frage nach Migration stellt und gleichzeitig Mädchen, die Fußball spielen, unterstützt, dann sind das total wichtige Zusammenschlüsse, die extrem niederschwellig neue Möglichkeitsräume für Leute aufmachen. Darum geht es auch, um Zusammenkünfte. Eine Prämisse, die wir mitnehmen sollten in die Allianzbildung ist, sich nicht spalten zu lassen und auch nicht in einen Wettbewerb dahingehend einzutreten, dass ein Raum wichtiger als der andere ist. Das ist die Strategie der Kapitalseite: ein ständiges „Auseinanderdividieren“. Wenn eine Gruppe sich für einen bestimmten Raum einsetzt, dann wäre es wichtig, im selben Atemzug in größeren Netzwerken die Raumforderungen anderer im besten Fall mit zu fordern, jedenfalls aber nicht damit zu konkurrieren, sondern über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Das ist die Stärke jeder Allianzbildung. Im Grunde geht es darum, den eigenen Raum als den prekären Teil eines größeren prekären Netzwerkes zu sehen und eigentlich im Großen wie im Kleinen zu denken und zu kämpfen.
IG Kultur Steiermark: Welche Rolle soll Politik in diesen Allianzen spielen?
Gabu Heindl: Das müssen die Menschen, die in die institutionelle Politik gegangen sind, immer wieder für sich selbst ausloten. Ich glaube nicht, dass sie eine paternalistische oder maternalistische Rolle spielen sollten. Sie sollten nicht nur quasi "die Leute da draußen" verwaltend betreuen, sondern ihre Definitionsmacht hinterfragen, und durchaus unerwartete bzw. nicht vordefinierte Räume und eine offene Raumgestaltung möglich machen. Wer dafür offen ist, wird noch viel interessantere Räume erhalten, als man sie überhaupt am Reißbrett der Institutionen-Politik zeichnen könnte.
IG Kultur Steiermark: Letzte Frage: Ist Stadtplanung bzw. das Praktizieren von Architektur auch eine politische Praxis?
Gabu Heindl: Ich glaube, dass jede Praxis eine grundsätzlich politische ist. Ob das Architekturstadtplanung ist oder die IG Kultur oder das Betreiben eines Bioladens oder einer Metzgerei, man kann eigentlich nichts ohne eine politische Haltung machen, übernehmen und/oder gestalten.
Gabu Heindl (Wien) ist als Architektin, Stadtplanerin, Universitätsprofessorin und Aktivistin international tätig. Seit dem Wintersemester 2022/23 hat sie die Leitung des Fachgebiets für Bauwirtschaft und Projektentwicklung “Architektur Stadt Ökonomie” an der Universität Kassel inne. Im Jahr 2022 erschienen die 3. Auflage ihres Buches Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung (Mandelbaum, Wien) sowie die Studie Gerechte Stadt muss sein! Studie zur Bestandsanalyse und Zukunftsorientierung einer gerecht(er)en Stadtplanung mit Schwerpunkt Wien (AK WIEN).
Das Interview führte Lidija Krienzer-Radojević.
Illustration: Susi Possnitz
